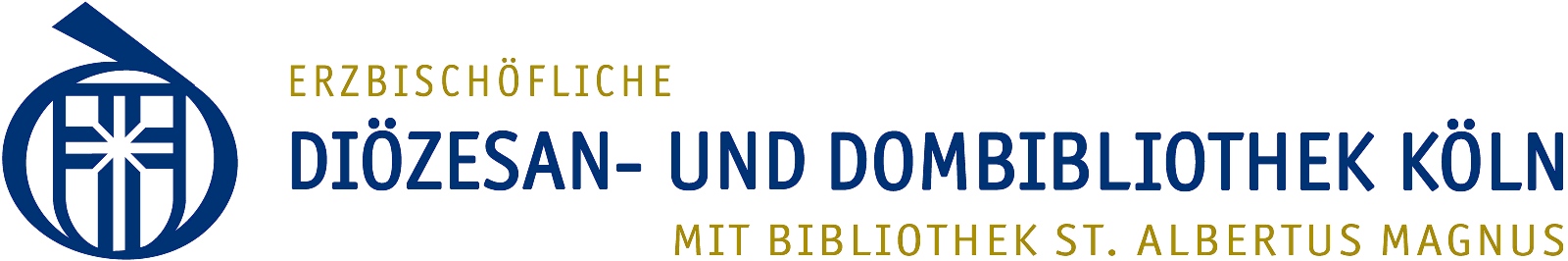Vermächtnis eines Domherrn: Der Ordo missae des Konrad von Rennenberg (Cod. 149)
Ein Ordo missae oder Messordo ist eine strukturierte Zusammenstellung der feststehenden Teile und Texte der hl. Messe mit Angaben über deren Verlauf. Die Handschrift Cod. 149, der sogenannte Rennenberg-Codex, enthält Texte nur für jene festlichen Messen, denen der Dekan des Kölner Domkapitels vorstand.

Ein Ordo missae oder Messordo ist eine strukturierte Zusammenstellung der feststehenden Teile und Texte der hl. Messe mit Angaben über deren Verlauf. Die Handschrift Cod. 149, der sogenannte Rennenberg-Codex, enthält Texte nur für jene festlichen Messen, denen der Dekan des Kölner Domkapitels vorstand. Auftraggeber dieser Handschrift war der 1357 verstorbene Domdekan Konrad von Rennenberg. Er stammte aus einer einflussreichen Familie von Edelherren, aus der seit 1220 zahlreiche Würdenträger des Kölner Domkapitels hervorgingen. Der Codex wurde um 1350, also noch zu Konrads Lebzeiten angefertigt; ein Eintrag auf der ersten Seite vermerkt jedoch, dass er nach dessen Tod der Kölner Domkirche vermacht worden war (fol. 1r). Die mit dieser Memorienstiftung verbundenen Auflagen – in der Regel waren dies Messen und Fürbitten für das Seelenheil des Stifters – sind nicht genauer benannt; ein Testament ist ebenfalls nicht erhalten. Noch im 16. Jahrhundert wurde die Handschrift offenbar unter Konrads Amtsnachfolgern weitergereicht, wie ein weiterer Eintrag zu Beginn der Handschrift belegt.
Der Codex ist in höchst repräsentativer Weise ausgestattet. Er gilt als wichtiges buchkünstlerisches Werk des Kölner Klarissenkonvents, dessen Produktionen einen Höhepunkt der Kölner Buchmalerei des Mittelalters darstellen. Eine führende Rolle nahm dabei die 1315 in das Klarenkloster eingetretene Nonne Loppa vom Spiegel ein, deren Familie in enger Beziehung zu den Rennenbergern stand.

Zunächst beherrschen mit feinster Feder ausgeschmückte Fleuronnée-Initialen in Rot und Blau sowie einfache Lombarden die Gestaltung vieler Seiten. Den Hauptblickfang in diesem Codex bildet jedoch eine ganzseitige Kreuzigungsdarstellung zu Beginn des Messkanons (fol. 51v). Auffällig ist die weitgehend emotionslose Darstellung der Szene: Die ausdruckslosen, in sich selbst versunkenen Gesichter von Maria und Johannes vermitteln eine zutiefst meditative Haltung. Gesichtsausdruck und Körperhaltung des toten Christus rufen kaum den Eindruck schmerzverzerrten Leidens hervor, sondern eher den eines ergebenen Ertragens. Dem Betrachter sollte dadurch ein Vorbild geboten werden, die Kreuzigung von ihrer Funktion in Gottes Heilsplan her reflektierend zu deuten und zu verehren.

Die gegenüberliegende Seite (fol. 52r) enthält den Beginn des eucharistischen Hochgebets selbst mit seinen Rubriken, den rot geschriebenen Handlungsanweisungen für den Priester. In der historisierten Initiale T(e igitur) ist das nun folgende Geschehen bildlich dargestellt: Ein Priester am Altar erhebt die Hostie zur Wandlung; hinter ihm kniet ein Ministrant, der eine große gewundene Kerze hält. Die reich verzierten, teils mit Gold belegten Randleisten dieser Seite werden von Vögeln und drolligen Phantasiewesen bevölkert. Schwungvoll laufen sie aus in Ranken mit spitzen dreieckigen Blättern, die zusammen mit der stachelartigen Bewehrung als künstlerisches Vorbild den Franziskaner Johannes von Valkenburg erkennen lassen (vgl. Cod. 1001b).