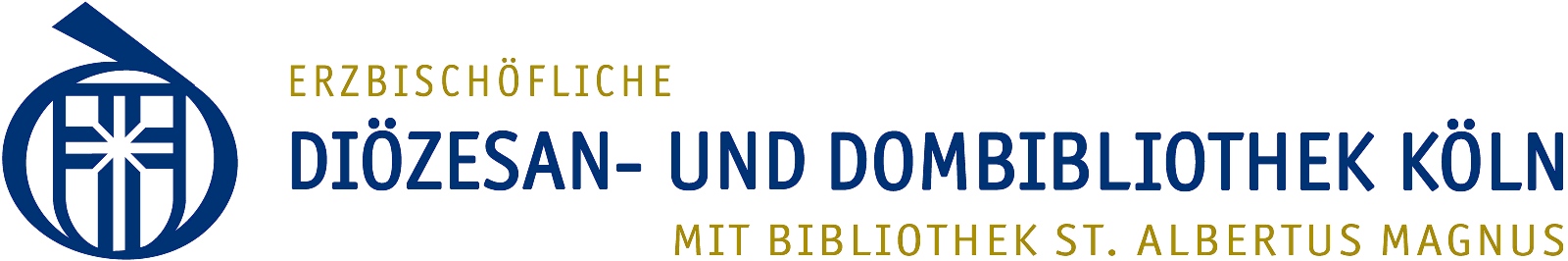Die „Kölner Nonnenhandschriften“ aus Chelles (Cod. 63 – 65 – 67)
Merowingische Kunst – karolingische Schrift: Die „Kölner Nonnenhandschriften“ aus Chelles (Cod. 63 – 65 – 67)
Die drei Handschriften mit den Kommentaren des Kirchenvaters Augustinus zu den alttestamentlichen Psalmen wurden um 800 in der Frauenabtei Chelles bei Paris von namentlich genannten Schreiberinnen hergestellt. Sie sind ein Beleg für die intellektuelle und kulturelle Blüte des Klosters wie auch für seine enge Verbindung zum Hof Kaiser Karls des Großen.

Die französische Kleinstadt Chelles liegt an einer Schleife der Marne etwa 18 km östlich von Paris. Bereits in der gallo-römischen Epoche gab es dort ein Landgut namens Kala, in das sich häufig die merowingischen Könige zurückzogen. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts gründete Chrodechilde, die Ehefrau des ersten getauften fränkischen Königs Chlodwig I., in der Nähe ein kleines Kloster für Frauen. 658/659 wurden die Gebäude durch die Königin Bathilde erweitert und das Kloster zur Abtei erhoben. Bertila, die erste Äbtissin des Klosters, kam mit einer Gruppe von Nonnen aus Jouarre, einem etwa 50 km östlich von Chelles gelegenen Doppelkloster.
Große intellektuelle Ausstrahlung erlangte die Abtei Chelles in der Karolingerzeit, als Gisela, die Schwester Karls des Großen, dort Nonne bzw. Äbtissin war (amt. 788–810). Aus ihrem lebhaften Briefwechsel mit dem Theologen Alkuin von York geht hervor, wie intensiv sie am geistigen Leben der Hofgesellschaft teilnahm, ja sogar Einfluss darauf hatte: Auf Bitten von Gisela und ihrer Nichte Rotrud, ebenfalls Nonne in Chelles, verfasste Alkuin um 800 einen umfangreichen Kommentar zum Johannes-Evangelium, den er den beiden Frauen widmete.

Ein Skriptorium zur Herstellung von Handschriften scheint aber schon um 700 in Chelles existiert zu haben. Über einen Zeitraum von etwa 120 Jahren lassen sich insgesamt 29 Codices nachweisen, die durch typische Merkmale ihrer Schrift, aber auch durch Ähnlichkeiten im Buchschmuck miteinander verbunden sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein um 750 entstandenes Sakramentar in der Biblioteca Vaticana (Cod. Reg. lat. 316), das neben der hergebrachten unzialen Schrift bereits Elemente einer eigenständig entwickelten Minuskelschrift enthält. Außerdem zeichnet es sich durch prachtvollen Buchschmuck im merowingischen Stil aus, in dem aus Fischen, Vögeln oder anderen Tieren gebildete Buchstaben eine wesentliche Rolle spielen.
Die drei Codices 63, 65 und 67 der Kölner Dombibliothek sind ebenfalls ein Produkt der Schreibstube von Chelles. In den ersten beiden Bänden ist der Buchschmuck noch bescheiden: Die Initialbuchstaben bestehen dort überwiegend aus rot konturierten Hohlkapitalen mit Füllungen in Rot, Grün und Gelb. Eine außerordentlich feierliche Eröffnung bietet dagegen Cod. 67, fol. 2v: Die Überschrift nimmt hier drei Zeilen ein und besteht zunächst aus Hohlkapitalen, die mit Flecht- und Schlangenbändern in Rot, Grün, Gelb und Purpur gefüllt sind. Die erste Initiale „I“ endet in einem spitz zulaufenden Blatt; an der oberen linken Ecke ist eine Blattranke angedeutet. Der Text selbst beginnt mit einer sechs Zeilen hohen Schmuckinitiale „E“, die aus drei mehrfarbigen Fischen gestaltet wurde. Hier zeigt sich am deutlichsten der Bezug der Kölner Handschriften zu den älteren Produkten aus Chelles wie etwa dem oben erwähnten Sakramentar. Besonders die Gestalt der Fische findet dort ihr Vorbild: In beiden Codices enden die bunt geschuppten Leiber in dreigeteilten Schwänzen und sind beidseitig mit gezackten Flossen besetzt. Die Künstlerin von Cod. 67 bewahrt aber ihre Eigenständigkeit, indem sie die Hohlkapitalen der Überschrift nicht, wie im Vorbild, mit Blättern, sondern mit Flechtbändern füllt. Darin zeigt sich deutlich der insulare Einfluss, der seit der frühen Karolingerzeit folgenreich auf die Buchmalerei einwirkte.

Die drei Handschriften aus Chelles wurden wohl auf Anforderung des Kölner Metropoliten Hildebald (amt. 787-818) angefertigt. Wie neun weitere Codices der Dombibliothek tragen sie auf der ersten Seite einen Besitzvermerk mit dem Hinweis, dass sie zur Zeit dieses Erzbischofs geschrieben worden seien: „Codex sancti Petri sub pio patre Hildebaldo scriptus“ (Cod. 67, fol. 1r). Als enger Vertrauter Karls des Großen und oberster Geistlicher seines Hofes gehörte Hildebald von Köln zu den wichtigsten Bischöfen des Karolingerreichs. Durch die Begründung eines Skriptoriums an der Kölner Kathedralschule und den Aufbau einer eigenen Bibliothek verschaffte er sich die Grundlagen für die Durchsetzung der karolingischen Bildungsreform in seinem Sprengel. Neben eigenen Erzeugnissen finden sich in der Dombibliothek auch zahlreiche Codices aus fremder Produktion – wie eben jene aus Chelles –, die die nahezu europaweite Vernetzung karolingischer Schreibstuben widerspiegeln.
Die Kölner Handschriften enthalten die Kommentare des Kirchenvaters Augustinus von Hippo († 430) zu den 150 alttestamentlichen Psalmen. Der Text wurde wegen seines großen Umfangs auf drei Bände mit jeweils fünfzig Psalmenkommentaren aufgeteilt. Außerdem teilten sich mehrere Schreiberinnen diese Aufgabe, deren Namen – und dies ist das Besondere an den Kölner Handschriften – am Ende ihrer Lagenserie vermerkt sind. Genannt werden Girbalda, Gislildis, Agleberta, Adruhic, Altildis, Gisledrudis, Eusebia, Vera und Agnes; ein weiterer Name ist mit dem letzten Blatt einer Lage verloren gegangen. Bereits die Subskriptionen der Namen weisen auf den hohen sozialen Stand der Nonnen hin. Gislildis und Gisledrudis könnten sogar zu den Blutsverwandten des Kaisers gehört haben, da sie den gleichen Namensstamm Gisl- aufweisen wie dessen Schwester Gisela/Gisla.

Vielleicht ist darin auch der Grund zu erkennen, warum sich im Abschnitt der Gislildis (Cod. 63, fol. 87r - 174v) charakteristische Randmarkierungen finden. Durch ein ausgeklügeltes System von verschiedenen Symbolen markierte sie bestimmte Passagen von Augustinus’ Text, die ein kohärentes Interesse an bestimmten Themen erkennen lassen. Die Innerlichkeit der religiösen Erfahrung ist solch ein Thema; Augustins Ausführungen zum Zustand des sündigen Menschen, zu Beichte und Buße werden ebenfalls markiert. Es sind dies Themen, die auch für die Amtsführung Karls des Großen und seiner Vertrauten bestimmend waren. Die Markierungen der Nonne Gislildis zeigen somit, dass sie die Texte Augustins nicht nur durchdrungen und verstanden hatte, sondern auch – im Hinblick auf den hochstehenden Auftraggeber der Handschrift – sensibel auf relevante Themen hinzuweisen wusste. Darin lässt sich sowohl ein Beleg für die intellektuelle Blüte der Frauenabtei Chelles in der Karolingerzeit erkennen, als auch für ein dort vorhandenes Bewusstsein für die Anliegen des Kaisers, so dass letztlich Chelles als Teil der Hauptströmung der karolingischen Hofkultur angesehen werden muss.