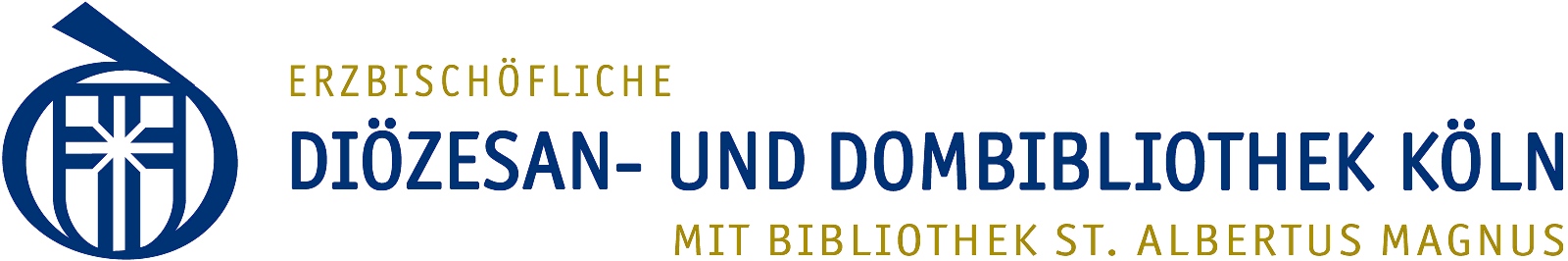Das mittelniederdeutsche Stundenbuch Cod. 1117
Pracht und Andacht für Laien: Das mittelniederdeutsche Stundenbuch Cod. 1117
Das um 1500 in Köln entstandene Stundenbuch vereint betrachtende Gebete für Laien mit prachtvoller niederländischer Renaissance-Malerei.

Stundenbücher sind Andachtsbücher für den Gebrauch von Laien - Frauen wie Männern. Sie entstanden in Analogie zu den Tagzeitenbüchern (Breviarien) des Klerus, enthielten aber neben dem Psalter vor allem Marien- und Totenoffizien, Gebetsstunden zur Passion Christi, zum Heiligen Geist, und weitere betrachtende Gebete. Da sie meist von Adligen in Auftrag gegeben wurden, stattete man die Stundenbücher seit dem 14. Jahrhundert mit zunehmend kostbarerem Buchschmuck aus. So wurden sie schon für die Zeitgenossen zur bibliophilen Kostbarkeit schlechthin – man denke nur an die berühmten „Très Riches Heures“ des Herzogs Jean de Berry.
Das Stundenbuch Cod. 1117 der Diözesanbibliothek steht ebenfalls in dieser Traditionslinie, auch wenn es nicht die Perfektion seiner französischen Vorbilder erreicht. Geschrieben wurde es um das Jahr 1500 durch Heinrich Zonsbeck, Mönch der Benediktinerabtei Groß St. Martin zu Köln, in einer gleichmäßigen gotischen Buchschrift, der Textualis formata. Die Sprache – ein gelderländischer Dialekt des Westniederdeutschen – wurde sowohl im niederrheinischen wie niederländischen Raum verstanden und lässt den wohl adligen Auftraggeber in ebendieser Region vermuten.

Von überwältigender Schönheit ist jedoch die Malerei in diesem kleinformatigen Buch. Die einzelnen Gebetszyklen der Handschrift werden durch sieben ganzseitige Miniaturen eingeleitet, die jeweils von einem reich mit Blüten und Blattranken verzierten Rahmen umgeben sind – so beispielsweise bei den Horen zum Heiligen Geist (fol. 81v). Gegenüberstehend (hier fol. 82r) und im Text selbst finden sich sodann 17 weitere halbseitige Miniaturen in Deckfarbenmalerei.

Am Beginn der einzelnen Tagzeiten stehen mehrzeilige historisierte oder aus Ornamenten gebildete Initialen mit aufwändigem Randschmuck – herausragend etwa die frei gestaltete „G“-Initiale bei der Non (fol. 87v) im Heilig-Geist-Zyklus. Der gezielte Einsatz von Gold hinterlässt beim Betrachter bzw. Beter dabei einen überaus prachtvollen Eindruck.

Die anonym gebliebenen Künstler waren wohl Wandermaler aus der nordniederländischen „Werkstatt des Meisters der schwarzen Augen“, die auch an zahlreichen anderen Stundenbüchern mitgewirkt haben. Ihre unterschiedliche Schulung lässt sich im Detail erkennen. So ist im Bild von Mariä Verkündigung (fol. 7v) die naturalistische Darstellung von Pflanzen und Tieren vereint mit Akanthusranken in Grisaille-Malerei, einem Element des neu aufkommenden grotesken Stils.

Die Geschichte von David und Batseba am Beginn der sieben Bußpsalmen dagegen (fol. 107v) zeigt eine höfische Szene ganz nach dem Vorbild der französischen Stundenbücher und mit eher traditionellem Streublumenrahmen.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts befand sich das Kölner Stundenbuch in der Privatbibliothek des Abbé Bignon, Bibliothekar des französischen Königs, und wurde dort neu eingebunden. Bei dieser Gelegenheit dürfte auch das Pfingstbild eingefügt worden sein, das wesentlich älter ist als die Malereien im Stundenbuch – es zeigt die Jünger und Maria im Rahmen einer historisierten Initiale „D“ und stammt wohl aus einem Graduale des 14. Jahrhunderts. Die ersten Blätter und der Vorderdeckel des Buches waren bislang durch häufigen Gebrauch stark beschädigt, konnten aber dank der großzügigen Spende eines Kunsthistorikers im Jahr 2019 restauriert werden.