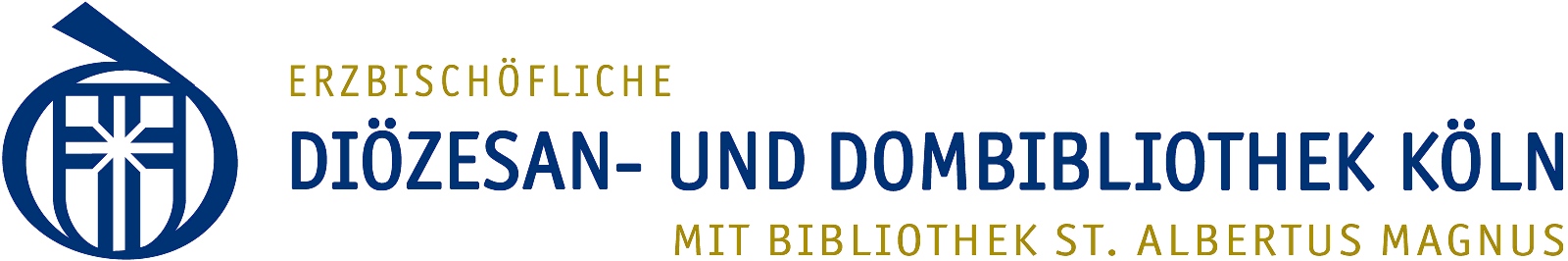Aus der Frühzeit zisterziensischer Tradition – Antiphonale (Winterteil) für St. Mechtern (Cod. 1161)
Die Zisterzienserinnen von St. Apern in Köln hatten ihr Kloster ursprünglich vor den Mauern der Stadt, wo St. Gereon und seine Gefährten das Martyrium erlitten hatten – auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils Ehrenfeld. 1474 von dort vertrieben, nahmen sie auch älteste liturgische Bücher mit in ihre neue Bleibe, wie diesen Codex aus dem 12. Jahrhundert. Er gilt als authentisches Zeugnis der frühen zisterziensischen Traditionen, die sich von anderen Orden stark unterscheiden.

In der Kolumne des Monats Februar 2025 wurde das Zisterzienserinnenkloster St. Apern vorgestellt. Aus dessen Besitz stammt offenbar auch Cod. 1161 der Diözesanbibliothek – so vermerkt es ein Eintrag aus dem 19. Jahrhundert auf dem ersten Blatt der Handschrift, als das Chorbuch in die Bibliothek des Priesterseminars eingegliedert wurde. Erneut handelt es sich hier um den Winterteil eines Antiphonars, und erneut ist das Hochfest des hl. Benedikt (21. März) mit einem eigenen und ausführlichen Formular enthalten (fol. 96r - 100r, hier 96v: Responsorium „Fuit vir“). Seine Anfertigung für eine Ordensgemeinschaft, die dessen Ordensregel folgt (Benediktiner, Zisterzienser, Trappisten u.a.), ist also sehr wahrscheinlich. Allerdings ist diese Handschrift schon auf den ersten Blick bedeutend älter als der auf 1539 datierte Cod. 1181 des Vormonats: sie stammt wohl aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Mithin kann sie gar nicht für den Gebrauch in St. Apern angefertigt worden sein, sondern war für den Vorgängerkonvent in St. Mechtern bestimmt.

Zur Erinnerung: Im Jahr 1474/77 wurde eine kleine Gemeinschaft von Klausnerinnen aus St. Apern umgesiedelt, um Platz zu machen für die Zisterzienserinnen aus St. Mechtern. Der merkwürdig anmutende Name ist der kölnische Ausdruck für „ad Martyres“, zu den heiligen Märtyrern also. Eine Kirche mit diesem Namen ist erstmals 1180 an jener Stelle vor den Stadtmauern Kölns bezeugt, an der gemäß der Legende die Märtyrer der Thebäischen Legion – Gereon, Victor, Cassius und Florentius mit Gefährten – getötet wurden. Erzbischof Philipp von Heinsberg siedelte dort zunächst Augustiner-Chorherren an. 1276 wurden Kloster und Kirche durch einen Brand zerstört; anstelle der Chorherren erhielten Zisterzienserinnen aus dem Kloster Benden bei Brühl den Besitz. Trotz der ungeschützten Lage zog das Kloster Frauen aus den führenden Kölner Familien an und gelangte schnell zur Blüte. Als 1474 im Verlauf der Kölner Stiftsfehde eine Belagerung der Stadt durch burgundische Truppen drohte, wurde das Kloster abgerissen und der Konvent nach St. Apern verlegt – zunächst provisorisch, ab 1477 dann mit päpstlicher Genehmigung. (fol. 1r)

Die geistliche Leitung des Frauenkonvents zu Mechtern (und später St. Apern) oblag den Äbten von Altenberg. Analog zu dem im 16. Jahrhundert entstandenen Cod. 1181 könnte man daher vermuten, dass auch Cod. 1161 bereits im Skriptorium der bergischen Zisterzienser angefertigt worden sei (fol. 80v). Jedoch sind für das 12. oder 13. Jahrhundert keine vergleichbaren Handschriften aus Altenberg erhalten. Ähnlichkeiten in Schrift und einfachen Zierbuchstaben zeigt zwar das zeitgleiche Graduale aus dem Kloster Kamp am Niederrhein, das heute als Ms. D 6 in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf aufbewahrt wird. Die Gestaltung der beiden einzigen deckfarbenen Zierinitialen weicht jedoch sehr stark ab, so dass eine Zuschreibung an diese Zisterze unmöglich erscheint.

Der Blattgold-Auftrag auf den Körpern der Buchstaben „A“ zum 1. Advent (fol. 1r) und „H“ zum Weihnachtstag (fol. 18r) steht ohnehin im Widerspruch zu den zisterziensischen Vorstellungen vom rechten Schreib- und Malstil. Dieser geht auf Bernhard von Clairvaux († 1153) zurück, der die Einfachheit zum Ideal für alle klösterlichen Lebensbereiche machte. Ein Generalkapitel forderte schon 1134, dass die Buchstaben einfarbig und ohne Schmuck gehalten sein sollten. Auch durfte kein kostbarer Einband die Bücher schmücken. Zwar wurden diese Bestimmungen bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts aufgeweicht, wie man etwa an der Kamper Buchmalerei sieht, die ihre Spaltleisteninitialen virtuos mit den Farben Rot, Blau, Grün und Gelb versieht. Metallisches Gold spielt darin allerdings keine Rolle. In unserem Cod. 1161 sind die rot konturierten Blattranken der beiden Deckfarben-Initialen zudem eher schwach und ungelenk ausgeführt, was ebenfalls gegen Kamp spricht.

Die zahlreichen einfarbigen Zierinitialen in Rot oder kräftig-orangem Mennige stehen mit ihren Fleuronnée-Verzierungen dagegen in der Tradition der rheinisch-maasländischen Buchmalerei (fol. 55v). Ihre gekonnt und wohl mit Zirkel und Lineal konstruierten Formen lassen einen geübten Zeichner erkennen, geben aber keine weiteren Hinweise auf ihre genaue Herkunft. Gleiches gilt für die leicht rundliche frühgotische Schrift, die noch ohne die zahlreichen Brechungen und Haarlinien der späteren Textura auskommt. Ihre Buchstabenverbindungen sind jedoch bereits stark ausgeprägt, sichtbar vor allem an den Schäften von i, m, n und u. Mindestens ein weiterer Schreiber nahm Korrekturen oder Ergänzungen vor. Bei ihm sind die Buchstaben etwas gedrungener; vor allem aber unterscheidet er sich durch die Verwendung des geraden d vom Hauptschreiber, der noch unziales d verwendet (z.B. fol. 7r unten).

Die Melodien in diesem Antiphonale entsprechen dem Gregorianischen Choral, dem traditionellen klösterlichen Gesang, gemäß der zisterziensischen Überlieferung. Auch sie folgen also der Tendenz dieses Ordens zur Vereinfachung: Gegenüber der benediktinischen Tradition sind die Melodien verkürzt und enthalten weniger Melismen. Die sehr schlanken Noten in Cod. 1161 stehen auf einer frühen Entwicklungsstufe von den linienlosen Neumen hin zur Hufnagelnotation mit ihren deutlich verdickten Köpfen. Sie stehen auf einem Vierliniensystem, bei dem die untere F-Linie in Rot und die C-Linie in einem (heute stark verblassten) Gelb gezogen sind (fol. 77v). Da sich die Linienstruktur immer dem Verlauf der Melodie anpasst, wechselt die Position der farbigen Linien und der Notenschlüssel häufig – eine Praxis, die sich bis in jüngste Ausgaben gregorianischer Gesänge erhalten hat. Sie folgt auch aus der Tatsache, dass diese Notenschrift keine absoluten Tonhöhen angibt und erspart den Schreibern die Hilfslinien bei sehr hohen oder sehr tiefen Tönen.